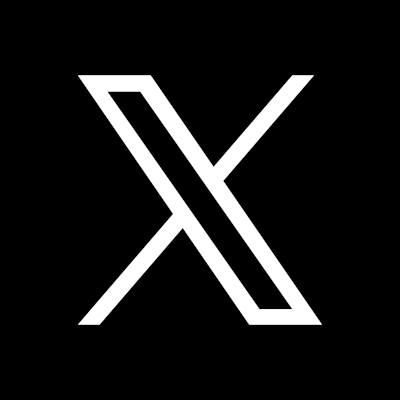Aktuelles
 "Jeder vermeintliche Umweg ist ja am Ende ein Zugewinn" – In
dieser Folge unterhalten sich Beate und Maria mit Dr. Ulrike Berg über
unterschiedliche Weiterbildungsabschnitte, das Thema
Weiterbildungsverbünde und individuelle Schwerpunkte in der
Allgemeinmedizin. Ulrike Berg hat ursprünglich BWL studiert, ist nun
niedergelassene Hausärztin und gibt uns unter anderem einen Einblick,
wie verschiedene „Abzweigungen“ des Weiterbildungswegs ihre heutige
Arbeit bereichern – und welche „Umwege“ sie Ärzten/innen in
Weiterbildung empfehlen würde.
"Jeder vermeintliche Umweg ist ja am Ende ein Zugewinn" – In
dieser Folge unterhalten sich Beate und Maria mit Dr. Ulrike Berg über
unterschiedliche Weiterbildungsabschnitte, das Thema
Weiterbildungsverbünde und individuelle Schwerpunkte in der
Allgemeinmedizin. Ulrike Berg hat ursprünglich BWL studiert, ist nun
niedergelassene Hausärztin und gibt uns unter anderem einen Einblick,
wie verschiedene „Abzweigungen“ des Weiterbildungswegs ihre heutige
Arbeit bereichern – und welche „Umwege“ sie Ärzten/innen in
Weiterbildung empfehlen würde.
Mehr dazu in der dritten Folge des Podcast rund um die Weiterbildung "Wege der Allgemeinmedizin" des Kompetenzzentrums Weiterbildung Hessen.
"Der große Aufwand nimmt der Impfkampagne den Schwung", sagt Ferdinand Gerlach. "Wenn wir an diesen Bedingungen nichts ändern, wird das Impfen nicht schnell genug gehen."
Gerlach ist Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt und forscht seit Jahrzehnten zum deutschen Hausärztesystem. Er findet es richtig, das Impfen vor allem den Hausärzten zu überlassen, schon weil viele alte Menschen allein zu Hause lebten und von den Impfzentren nicht erreicht würden. Unterstützt werden müssten sie aber noch viel stärker von mobilen Teams und Pop-up-Impfstationen in Einkaufszentren oder Sportvereinen – eine Strategie, mit der Bremen auf eine Impfquote von über 80 Prozent gekommen ist. Und noch etwas sei dringend erforderlich, sagt Gerlach: "Wertschätzung!" Während der gesamten Pandemie seien Aufgaben an die Hausärzte verteilt worden, ohne die Konsequenzen für die oft ohnehin ausgelasteten Praxen zu bedenken.
Was selten erwähnt wird: Große Teile dieser Arbeit übernehmen die
medizinischen Fachangestellten, die MFAs. "Im Gegensatz zu den
Pflegerinnen in den Kliniken haben die MFAs aber noch nie einen Bonus
vom Staat bekommen", sagt Gerlach. Für ihn sind sie die wahren Heldinnen
der Impfkampagne – und die entscheidende Größe, auf die es jetzt
ankommt.
Die Zeit, 17.11.2021: Boosterimpfung: Schaffen die Hausärzte das?
"Laut Experten macht der Klimawandel Menschen krank und gilt als die größte globale Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts. Diese Auswirkungen sind schon heue ganz real. Klimasensible Krankheiten nehmen zu und auch die Sterblichkeit, die damit verbunden ist. Der Klimawandel hat nachweislich Folgen auf unsere Gesundheit." sagt Moderatorin Nadine Krüger.
ZDF "Volle Kanne"
Ab Minute 52:55 zum Thema "Gesundheit und Klimawandel" mit Dr. Beate Müller als Leiterin der AG Klimawandel und Gesundheit.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um während der Weiterbildung Allgemeinmedizin aus der Klinik in die Praxis zu wechseln?
Mehr dazu in der zweiten Folge des Podcast rund um die Weiterbildung "Wege der Allgemeinmedizin" des Kompetenzzentrums Weiterbildung Hessen.
Folge 2: Aus der Klinik in die Praxis - mit Silva Zitzmann
Lust auf Forschung in der Hausarztpraxis?
Forschungspreis 2022 der DESAM-ForNet
Innovative Forschungsprojekte oder -ideen zur Förderung von Forschung im hausärztlichen Setting gesucht!
VertreterInnen aller allgemeinmedizinischen Institute Deutschlands sowie HausärztInnen mit ihren Praxisteams sind aufgerufen, Beiträge zu Forschung aus der Praxis für die Praxis, die folgende Merkmale erfüllen, einzureichen:
- Niederschwellig im Kontext des hausärztlichen Praxisalltags durchführbar
- Attraktiv für PatientInnen, MFA und HausärztInnen
- Mit wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn verbunden
Es können sowohl abgeschlossene wissenschaftliche Arbeiten als auch Konzepte eingebracht werden.
Beitragseinreichung bis zum 6. Dezember 2021
Weitere Informationen zum Forschungspreis finden Sie auf den Seiten der Initiative Deutscher Forschungspraxennetze – DESAM-ForNet
Überwindung der Sektorengrenzen nötig
Die Studie "Gesundheitliche
Versorgung in Hessen - Bestandsaufnahme und Perspektiven" zeigt zwei Entwicklungen im hessischen Gesundheitssektor auf:
Im ambulanten (vor allem im hausärztlichen) Bereich ist ein zunehmender Ärztemangel insbesondere in ländlichen Regionen zu beobachten, der die Sicherstellung der flächendeckenden ambulanten Versorgung zukünftig immer schwieriger machen wird. Auf der anderen Seite weisen gerade die ländlichen Regionen in Hessen eine ausgeprägte Infrastruktur kleinerer Krankenhäuser auf, die in einem starken wirtschaftlichen Wettbewerb um personelle und finanzielle Ressourcen stehen. Mit Blick auf den demografischen Wandel bei (Haus-) Ärzt_innen und Bevölkerung und die zunehmende Ambulantisierung stationärer Leistungen ist zu erwarten, dass sich diese Tendenzen weiter verstärken werden, wenn der aktuelle Zustand im hessischen Gesundheitswesen wie bisher fortgeschrieben wird.
Die im Rahmen des vorliegenden Gutachtens dargestellten Entwicklungen legen nahe, dass die
aktuellen und zukünftigen Probleme in der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung in Hessen (aber auch bundesweit) absehbar nur durch eine stärkere Überwindung der Sektorengrenzen lösbar sind.
Unklare Erkrankungen besser erkennen und behandeln
Das Universitätsklinikum Frankfurt hat ein Forschungsvorhaben auf den Weg gebracht, das niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnose von unklaren und seltenen Erkrankungen unterstützen wird: Ein smartes Arztportal soll Patientinnen und Patienten unter anderem im ländlichen Raum bessere und schnellere Diagnosemöglichkeiten eröffnen. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat für die Förderung des SATURN-Projekts jetzt die Summe von 2,9 Millionen Euro bereitgestellt.
Das Institut für Allgemeinmedizin kümmert sich unter anderem um die Frage, welche Anforderungen die Nutzer haben. Außerdem evaluieren sie im letzten Projektabschnitt, ob das Projekt praktisch umsetzbar und nutzerfreundlich ist.
Pressemitteilung Universtitätsklinikum Frankfurt
AGENS Methodenworkshop 2022
24. und 25. Februar 2022
Universitätsklinikum Frankfurt
Der Arbeitsbereich Versorgungsepidemiologie
und die Arbeitsgruppe der Erhebung und Nutzung der Sekundärdaten
(AGENS) laden Sie herzlich zu dem AGENS Methodenworkshop 2022 in
Frankfurt ein.
Der Workshop soll als Plattform für den wissenschaftlichen Austausch von
Methoden bei der Nutzung von Routinedaten in der Versorgungsforschung
dienen.
Weitere Infos zum AGENS Methodenworkshop - Flyer
Wege der Allgemeinmedizin ist der neue Podcast zur Weiterbildung Allgemeinmedizin vom Kompetenzzentrum Weiterbildung in Hessen. Das Team aus einer Ärztin in Weiterbildung (ÄiW), einer jungen Fachärztin für Allgemeinmedizin sowie zwei Mitarbeiterinnen aus dem Kompetenzzentrum Weiterbildung unterhalten sich jeweils zu zweit mit einer interessanten Person, erfahrenen Hausärzten/Hausärztinnen und/oder Ärzten/Ärztinnen in Weiterbildung in lockerer Café-Atmosphäre rund um den vielfältigen Weg zur Fachärztin bzw. zum Facharzt für Allgemeinmedizin und über ganz unterschiedliche Themen rund um die Weiterbildung.
Die erste Staffel des Podcasts erscheint immer zum 1. bzw. 15. des Monats.
Weitere Informationen zum Podcast und bisher erschienenen Folgen sind hier anzuhören.
Nachwuchsakademie: Bewerben Sie sich jetzt
Die Nachwuchsakademie der Deutschen Stiftung für Allgemeinmedizin und
Familienmedizin (DESAM) stellt eine bundesweit einmalige und besondere
Förderung von an der Allgemeinmedizin und an der hausärztlichen
Versorgung interessierten Studierenden dar.
Sie bietet Medizinstudierenden in einem dreijährigen Förderprogramm ein
individuelles Mentoring durch erfahrene Allgemeinmediziner, die
Unterstützung bei Studium, wissenschaftlichem Arbeiten (z.B. in der
Promotion) und in der eigenen Berufsplanung.
Ab sofort können sich Medizinstudierende vom vierten bis achten Semester wieder um einen Platz bewerben. Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2022.
Weitere Informationen zu dem Förderprogramm finden Sie auf der Infokarte und auf den Seiten der DESAM.
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity